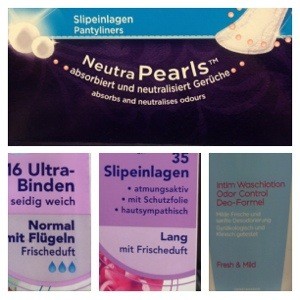Am Wochenende war ich bei „Text & Töne“ einer Veranstaltung des Literarischen Colloquiums Berlin. Wer noch nicht da war (mir ist das in mehr als zehn Jahren Berlin bislang entgangen), dem kann ich diesen Ort – unabhängig von der Veranstaltung – sehr ans Herz legen.
Am Samstag traten Dota, Cora Frost, Christiane Rösinger, Frank Spilker (Die Sterne) und Francesco Wilking (Tele) mit Moritz Krämer sowie Tilman Rammstedt (der las und nicht sang) auf.
Am 15. August gibt es übrigens den zweiten Teil des Konzert- und Leseabends und wer sich vorstellen kann, an einem lauen Sommerabend einigen SchriftstellerInnen und SängerInnen mit einem Glas kühlen Weißwein in der Hand zu lauschen, während hinter selbigen die Sonne im Wannsee untergeht, dem kann ich die Veranstaltung sehr ans Herz legen. Auch mit Kindern im Übrigen. Man kann eine Decke mitnehmen und ein paar Stullen und ein bisschen Kindergehopse rundet den entspannten Abend eher ab als dass es stört.
Jedenfalls was ich eigentlich schreiben wollte: Christiane Rösinger, eine der Gründerinnen der Lassie Singers, kannte ich noch nicht. Was mein Begleiter mittelmäßig verwundert feststellte: „Aber sie ist doch AUCH Feministin!“
Nun. Ich habe zwar italienische Vorfahren, aber leider kenne ich nicht jeden Ort in Italien und auch nicht jede regionale Spezialität. Das entrüstet meine Gesprächspartner gelegentlich (ABER DU BIST DOCH ITALIENERIN?), aber so ist es eben. Ich kenne auch nicht alle Feminstinnen. Auch nicht wenn sie singen, auch nicht wenn sie so großartige Texte singen.
(Im Übrigen könnte ich jetzt im Thesaurus „großartig“ eingeben, um die anderen SängerInnen des Abends zu beschreiben. Cora Frost zum Beispiel, die so inbrünstig performte und eine Strophe auf den Wannensee schrie und eine weitere zu meiner großen Freude gurgelte – aber es würde ja allen nicht gerecht. Einfach zum 2. Termin am 15. August hingehen!)
Christiane Rösinger sang von der Liebe und wie überbewertet sie ist und davon dass sie einen Faible für Idioten hätte und von der Sinnlosigkeit alles Handelns und das in ausgesuchter Fröhlichkeit. Es war ein Fest.
In einem der Lieder prangerte sie das Paarleben an. So blieb es mir in Erinnerung. Also den Drang sich eigentlich nur komplett und vollwertig in der Gesellschaft zu fühlen, wenn man eine/n PartnerIn hat. V.a. weil das der Jugend so vorgelebt werde, die ja dann mit dieser Idee aufwachse.
Mich haben diese Textzeilen sehr nachdenklich gemacht. Warum ist das eigentlich so? Warum hat man als erwachsener Mensch meistens das Gefühl irgendwas stimme nicht, wenn man nicht mit jemanden das Leben teilt? Irgendwie ist es bei den meisten ja ein Thema sobald sie allein sind: Die Partnersuche. Und was lebt man da tatsächlich den Kindern vor? Schwebt für meine Kinder wahrnehmbar mit „Die Mama bekommt das zwar alles hin, aber eigentlich wäre alles besser (?) wenn da noch jemand wäre.“?
Tatsächlich hat mir meine eigene Mutter immer vermittelt, dass das Wichtigste im Leben der Partner ist. Ohne Partner ist man nicht komplett. Dass ich jetzt wieder alleine lebe (was ja z.B. bezogen auf das Thema Kinder gesehen auf die Verantwortlichkeiten so auch gar nicht stimmt), beunruhigt sehr. Besser wäre es ja schon, wenn da jemand wäre, der für mich sorgt…
Gerade finde ich mein Leben im Alltag alleine ja sehr schön. Aber es überkam mich zumindest auch schon des öfteren das Gefühl das Schöne teilen zu wollen. Das Unschöne auch und überhaupt: das Teilen.
Es gibt von der WM ein Videoschnipsel eines deutschen Tors, in dem Angela Merkel hochspringt und sich freut. Eine Millisekunde später schaut sie sich suchend um, mit wem sie ihre Freude teilen kann, umarmt Gauck und schaut dann zur anderen Seite, ob sich die anderen mitfreuen. Putin sitzt derweil wie eine Statue daneben und freut sich betont nicht. Er unfreut sich kältlich sozusagen.
Um zum Thema zurück zu kommen. Ich habe diesen Teildrang auch. Ich vermute, viele – wenn nicht sogar alle Menschen haben ihn. Der Anblick eines Sonnenuntergangs ist schön. Man kann ihn sich alleine anschauen und genießen, aber irgendwie schlummert latent das Teilenwollen. Gemeinsam auf die untergehende Sonne blicken. Wenn das nicht geht, ein Foto machen, das Foto jemanden später zeigen oder – den sozialen Medien sei dank – das Foto instagrammen und es so teilen.
Ich weiß nicht, ob das Streben nach Zweisamkeit wirklich zum großen Teil von diesem Dinge mit jemanden teilen wollen angetrieben wird. Im Moment fühle ich es so. Und deswegen bin ich froh, dass es Twitter, Facebook und instagram gibt. Ich fühle mich dann nicht einsam. Ich hab Menschen dabei mit denen ich mein Erleben, meine Freude und manchmal auch meinen Frust und meine Traurigkeit teilen kann.
Ja, man kann jetzt wieder die ganze Diskussion mit den sogenannten „echten Menschen“ und der Wertigkeit der „echten Freunde“ führen. Man kann es aber auch sein lassen. Ich kenne den Unterschied nicht und manchmal, wenn ich mich zum Beispiel schlecht fühle und das twittere und mir jemand mit „.“ antwortet und mir damit einfach sagt: „Ich nehme dich wahr, ich fühle mit Dir, mehr gibt es nicht zu sagen.“, dann hilft mir das. Mich erreicht das Mitgefühl der anderen und es tut gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich für mich interessieren.
Hach ja, ich wollte gar keinen Jammertext schreiben. Viel mehr fühle ich mich wirklich ermuntert meinen Kindern nicht vorzuleben, dass ich nur jemand bin, wenn ich zu zweit bin. Dass etwas fehlt, wenn ich alleine lebe. Im Gegenteil. Ich hätte gerne, dass sie sehen, dass mir mein Leben gefällt, dass ich gerne eigene Entscheidungen treffe, dass es mir gut tut mich nicht permanent mit jemanden abstimmen muss. Dass es eben Vorteile gibt alleine zu leben – so wie es Vorteile gibt als Paar zu leben. Dass beide Formen gleichwertig sind, dass sie ihre Berechtigung haben, dass das eine nicht wertiger ist als das andere und dass es viele Formen von Gemeinschaft gibt, von Lebensmodellen. So dass sie aufwachsen mit jemanden vor Augen, der ihnen irgendwie eine Art Zuversicht schenkt, dass man sein Leben selbst gestalten kann, dass man die Wahl hat und dass man sich gegebenenfalls auch umentscheiden kann. Jederzeit. Mit 16, mit 30, mit 40 und auch noch mit 50 oder 60, jederzeit eben. Und dass sie verstehen, dass es viele Formen von Gemeinschaft und Beistand gibt.